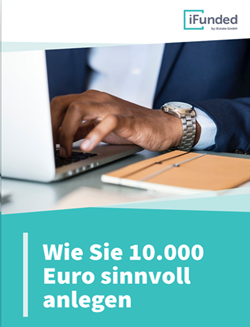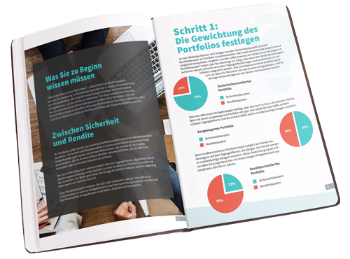ROE (Return on Equity)


ROE steht für die betriebswirtschaftliche Kennzahl Return on Equity. Auf Deutsch wird von der Eigenkapitalrendite gesprochen. Der ROE ist das Verhältnis von Eigenkapital und Gewinn eines Unternehmens im jeweiligen Geschäftsjahr. In der Finanzwelt handelt es sich beim ROE um eine extrem wichtige Kennzahl, um ein Unternehmen zu bewerten. Letztlich stellt der Return on Equity die Verzinsung dar, die der Eigentümer des Eigenkapitals erhält. Dabei muss jedoch immer berücksichtigt werden, dass die Eigenkapitalrendite branchenabhängig ist und auch durch andere Faktoren verfälscht werden kann.
Eigenkapitalrendite versus ROE
Bei den beiden Begriffen handelt es sich um ein und dasselbe. Der deutsche Begriff der Eigenkapitalrendite wird immer mehr verdrängt und durch den englischen Begriff ersetzt. Für den US-amerikanischen Investor und Erfinder der Value-Investment-Strategie Benjamin Graham (1894-1976) ist ein hoher Return on Equity die Grundlage für ein erfolgreiches Investment.
So wird der ROE berechnet
Um den Return on Equity zu berechnen, wird der Jahresüberschuss des Unternehmens durch das eingesetzte Kapital dividiert. Wenn also zum Beispiel ein Unternehmen 5 Millionen Euro Kapital zur Verfügung hat und einen Jahresgewinn von 1 Million Euro erzielt, liegt die Eigenkapitalrendite bei 20%. Zum Vergleich: Eigenkapitalrenditen ab etwa 10% werden als Indikator für ein gesundes Unternehmen gewertet. Große Beachtung fand das ROE-Ziel von 25% der Deutschen Bank, das die Bank unter der Führung von Josef Ackermann viele Jahre konsequent verfolgte.

Unterschiede je nach Branche
Zwar ist eine hohe Eigenkapitalrendite durchaus ein positives Zeichen für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass es je nach Branche Unterschiede gibt, die sich auf die Kennzahl auswirken können. Ein Automobilhersteller hat natürlich eine ganz andere Kostenstruktur als ein junges FinTech-Unternehmen. Beim Automobilhersteller wird viel Kapital für Maschinen gebunden und es sind sehr viele Mitarbeiter nötig. Ein FinTech-Unternehmen hat weitaus niedrigeren Kapitalbedarf. Bei gleichem Jahresüberschuss ist der ROE vom FinTech-Unternehmen folglich viel höher. Das muss allerdings nicht automatisch bedeuten, dass der Automobilhersteller weniger effizient gearbeitet hat.
Was den ROE verzerrt
Da der Return on Equity nur auf Basis des Eigenkapitals und nicht auf Basis des Gesamtkapitals berechnet wird, kann durch zusätzlich aufgenommenes Fremdkapital die Kennzahl verbessert werden. Dieser Effekt wird in Fachkreisen Leverage Effekt genannt.
Stille Reserven beachten
Auch die stillen Reserven müssen beachtet werden, weil sie das Ergebnis der Kennzahl verzerren können. Dabei greift das Unternehmen immer auf seine stillen Reserven zu. Gewinnsteigerungen gibt es daher nicht so oft, weil nur die eigenen Reserven verwendet wurden.
Was ein wirtschaftliches Unternehmen ausmacht
Wie bereits beschrieben, gibt es viele branchenspezifische Unterschiede und es kann nicht pauschal gesagt werden, ab welcher Eigenkapitalrendite von einem wirtschaftlich gut geführten Unternehmen gesprochen werden kann. Als Faustregel gilt jedoch, dass der Return on Equity mindestens so hoch sein sollte, wie der Zinssatz, der aktuell am Kapitalmarkt erzielt werden kann. Wenn der ROE nämlich unter diesem Zinssatz liegt, wäre es für Kapitalgeber wirtschaftlicher, ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen.