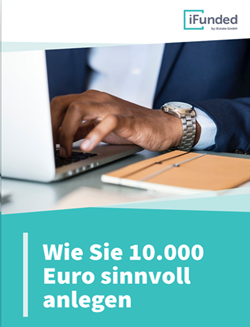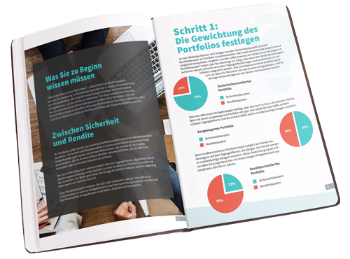Niedrigzins


Niedrigzinsphasen wechseln sich laut Wirtschaftstheorie zyklisch mit Hochzinsphasen ab. Wann von einem Niedrigzins die Rede ist, hängt vom Kontext und der subjektiven Bewertung ab. Viele Immobilienkreditnehmer halten Zinssätze von zwei Prozent beispielsweise für relativ hoch. Derselbe Satz ließe sich hinsichtlich der Geldanlage als Niedrigzins bezeichnen.
Die Inflationsrate dient bei der Einschätzung hoher und niedriger Zinsen als Referenzwert. Alle niedrigverzinslichen Geldanlagen zeichnen sich durch geringen Spareffekt aus. Vermögenszuwachs ist bei Niedrigzins kaum zu erwarten. Wie hoch der Spareffekt einer Geldanlage tatsächlich ist, ist neben dem Zinssatz vom Verbraucherpreisindex abhängig.
In Niedrigzinsphasen gewinnen Sachwerte und Konsumwünsche an Bedeutung. Das Niedrigzins- und Konsumzeitalter gehen deshalb Hand in Hand. Obwohl es Niedrigzinsphasen auch in der Vergangenheit gegeben hat, bezieht sich der Ausdruck insbesondere auf das 21. Jahrhundert. Derart konstante Niedrigverzinsung gab es in der modernen Volkswirtschaft selten. Der Grund für diese Entwicklung ist die globale Weltwirtschaftskrise.
Leitzins & Niedrigzins: Erklärung der Zusammenhänge
Im allgemeinen Sprachgebrauch bezieht sich der Ausdruck Niedrigzinsphase auf die drei Leitzinsen der Zentralbank. Zum Hauptrefinanzierungssatz nehmen Geschäftsbanken bei der Notenbank Kapital auf, um liquide zu bleiben. Entwicklungen im Hinblick auf Kredit- und Anlagezinsen orientieren sich am volkswirtschaftlichen Zinsniveau, das dieser Leitzins vorgibt.
Neben dem Leitzins ist der Interbankenzins in dieser Hinsicht relevant. Dieser Zinssatz bezieht sich auf den Handel zwischen Kreditinstituten und gibt die Entwicklungen der Marktzinsen vor. Die Geldmarktzinsentwicklung bestimmt hierbei die Zinsprognosen für kurzfristige Kredite und Anlagen. Hierzu zählen Bankeinlagen wie Termin-, Tages- und bestimmte Festgelder. Kapitalmarktzinsen wirken sich dagegen auf die mittel- bis langfristige Zinsentwicklung aus.
Grundsätzlich hängen mittel- und langfristige Zinssätze weniger vom Leit- als vom Durchschnittszins der langfristigen Staatsanleihen ab. Die Kennziffer der Umlaufrendite basiert auf dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Hiermit hängen Inflation und Wirtschaftswachstum zusammen. Welche Zinsen Einlagen und Anleihen generieren, bestimmt die konjunkturell monetäre Wirtschaftssituation.
Sparen bei Niedrigzins: Folgen der Mini-Zinssätze
In Deutschland sinken die Zinsen für Geldanlagen seit mehr als 30 Jahren. Der Diskontsatz der deutschen Bundesbank lag nach der Wiedervereinigung bei mehr als acht Prozent. Ab der Jahrtausendwende fiel während den Finanzkrisen der europäische Leitzins: mit Folgen für die Marktzinsen.
Während Fremdkapitalnehmer vom Niedrigzins profitieren, ist die Niedrigzinsphase für einen Großteil aller Sparer mit finanziellem Verlust verbunden. Sichere Geldanlagen sind im Niedrigzins-Zeitalter umkämpft. Unerfahrene Sparer laufen hierbei Gefahr, ihr angespartes Kapital in Folge unüberlegter Anlagepolitik zu verspekulieren. Negative Folgen der Niedrigzinsphase zeichnen sich vor allem im Hinblick auf die Altersvorsorge und das Zielsparen ab.
Mittlerweile müssen Sparer vergleichsweise hohe Risiken eingehen, um den Wert ihres Vermögens zu erhalten. Zur selben Zeit sind für befriedigende Resultate immer größere Summen erforderlich. Experten sprechen davon, dass deutsche Kontoanleger in Folge der Niedrigzinsphase jährlich Verluste in Millionenhöhe hinnehmen müssen.
Inflationsrate & Niedrigzins: Definition der Zusammenhänge
Ein Grund für die hohen Verluste deutscher Kontoanleger ist die gegenwärtige (Stand: 2018) Inflationsrate von 2,2 Prozent. Diese Entwicklung vereinnahmt bei einem durchschnittlichen Kontozins von unter einem Prozent Negativzinsen.
In der engeren Definition liegen Negativzinsen vor, wenn Sparer Zinssätze unter null für ihre Geldanlage vereinnahmen. Anstatt Rendite zu erwirtschaften, bezahlen sie sozusagen für die Verwahrung ihres Vermögens. Bei hoher Inflationsrate können auch Realzinssätze über 0 mit den Effekten einer Negativverzinsung einhergehen.
Die Inflationsrate bildet die jährliche Entwicklung des deutschen Verbraucherpreisindexes ab. Je teurer der Lebensunterhalt wird, desto höher ist die Geldentwertung für zurückgelegtes Vermögen. Weil sich die Inflationsrate seit 2015 mehr als verdreifacht hat, ist Ihr gegenwärtiges Vermögen derzeit nur noch ein Drittel so viel wert wie damals. Gleichzeitig folgt der Leitzins der EBZ im Jahr 2018 weiterhin der Nullzinspolitik.
Zinspolitik der EBZ: Wirtschaftswachstum durch Niedrigzinsen
Durch Niedrig- und Negativzinsen will die Zentralbank seit der globalen Wirtschaftskrise die europäische Wirtschaft ankurbeln. Je weniger Rendite Banken mit ihren Geldanlagen bei der Notenbank erwirtschaften, desto liquider sind sie. Dadurch erzielen sie mehr Umsatz im Kreditgeschäft. Tatsächlich unterbieten sich deutsche Kreditinstitute mittlerweile, was die Kreditfinanzierung betrifft.
Die Zinssätze für die Baufinanzierung sinken seit der Krise. Manche Kreditinstitute bieten Finanzierungsmöglichkeiten mit Negativzinsen an. Bei solchen Finanzierungen bekommen Sie im wahrsten Sinne des Wortes Geld geschenkt. Weniger erfreulich ist die Niedrigzinsphase für Kontoanleger. Sparer werden auf diese Weise zum Konsum stimuliert, wovon die Wirtschaft profitiert.
Seit Kreditinstitute wie die Sparkasse und Raiffeisenbank sämtliche Negativ- und Niedrigzinsen auf ihre Kunden umlegen, hat sich die Nullzinspolitik der EBZ für deutsche Kontoanleger zum Desaster entwickelt. Obwohl Experten die Strategie dahinter verstehen, bemängeln sie die bis heute anhaltenden Folgen. Für die nahe Zukunft bleiben die Prognosen schlecht. Um diese Vorhersage nachzuvollziehen, lohnt eine Ursachenanalyse.
Weltwirtschaftskrise: Niedrigzinsphasen verhindern Investitionsschwäche
2008 erfasst eine Finanzkrise die Weltwirtschaft. Die Notenbanken reagierten auf dieses Phänomen weltweit mit Leitzinssenkungen. Seitdem liegen die Zinsen bei einem Rekordtief. In der Eurozone erreicht der Leitzins 0,00 Prozent. In Schweden und der Schweiz herrscht mit -0,5 und -0,75 Prozent eine Negativzinsphase und sogar in den USA bewegen sich die Zinssätze unter der Ein-Prozent-Marke.
Zinsänderungen sind für die zentralen Notenbanken ein Instrument, um die Konjunktur der Wirtschaftsräume zu beeinflussen. Durch geldpolitische Stimuli sollen Wirtschaftswachstum und Inflation in Balance gebracht werden. Nach Sollzinssenkungen steigt die Liquidität. Unternehmen und Privatleute können neue Wirtschaftsvorhaben und Produkte dadurch leichter finanzieren. Die daraus resultierende Investitionslust wehrt Wirtschaftsschwäche ab.
Inflationsraten von über zwei Prozent treiben die Nachfrage nach Wirtschaftsgütern weiter an. Obwohl das Ausmaß und die Dauer der Krise im Jahr 2008 massive Leitzinssenkungen zur Abwehr der vorherrschenden Wachstumsschwäche erzwungen haben, konnte die europäische Wirtschaft seitdem kaum nennenswerte Fortschritte verzeichnen. Experten nennen hierfür unterschiedliche Gründe.
Schuldenkrise: Negativzinsen minimieren Staatsverschuldung
2008 wurde Geld in Umlauf gebracht. Trotzdem fehlt es Europa seit der globalen Wirtschaftskrise an produktiven und effektiven Investitionen. Deshalb hat die europäische Zentralbank weitere Lenkungsmaßnahmen ergriffen. Hierzu zählen Strafzinsen für Bankguthaben (Negativzinsen), die auf den Zentralbankkonten der Kreditinstitute eingeführt wurden.
Die EZB kaufte außerdem Staats- und Unternehmensanleihen am Kapitalmarkt auf. Billiges Geld floss dadurch in den Aktien- und Immobilienmarkt. Die hohe Nachfrage hat in einigen Ländern zu übertriebenen Preisentwicklungen geführt, wodurch weitere Krisen vorprogrammiert wurden. Mit diesen und ähnlichen Effekten hat die Niedrigzinspolitik den Verschuldungsgrad aller Wirtschaftsteilnehmer angehoben.
Der steigende Verschuldungsgrad betrifft nicht zuletzt den Staat. Um Insolvenz zu vermeiden und den Staat bei der Schuldentilgung zu unterstützen, halten die Zentralbanken an ihrer Niedrigzinspolitik fest. In Konsequenz zu negativen Zinssätzen „verdienen“ wirtschaftsstarke Länder wie Deutschland an neuausgegebenen Staatsanleihen und entgehen so trotz hoher Schulden der Insolvenz.
Prognose: Anlagezinsen bleiben niedrig
Ginge es nach dem ursprünglichen Plan der EBZ, so hätte die Niedrigzinsphase im Dezember 2017 ein Ende nehmen sollen. Doch auch im folgenden Jahr hat sich an den Niedrigzinsen kaum etwas verändert. Experten schätzen, dass die Sparzinsen über die kommenden Jahre weiterhin niedrig bleiben. Diese Finanzpolitik soll den raschen Eintritt weiterer Finanzkrisen verhindern.
Zumindest die Inflationserwartungen haben sich zaghaft zum Positiven entwickelt. Gleichzeitig verzeichnen europäische Wachstumsraten wieder steigende Tendenz. Anstiege im Hinblick auf den langfristigen Bauzins bestärken diesen Eindruck. Bis Anleger die Erholung der europäischen Wirtschaft an ihren Anlagezinsen nachvollziehen können, bieten sich Alternativen zur klassischen Geldanlage und Altersvorsorge an.
Zu den kostengünstigen Finanzprodukten zählen beispielsweise börsengehandelte Indexfonds, Crowdlending und schwankungsarmes Crowdinvesting im Hinblick auf Immobilien. Letztere Anlageform ermöglichen Ihnen Plattformen wie iFunded, wo Sie bereits mit kleinem Budget in erfolgsversprechende Immobilienprojekte investieren können.